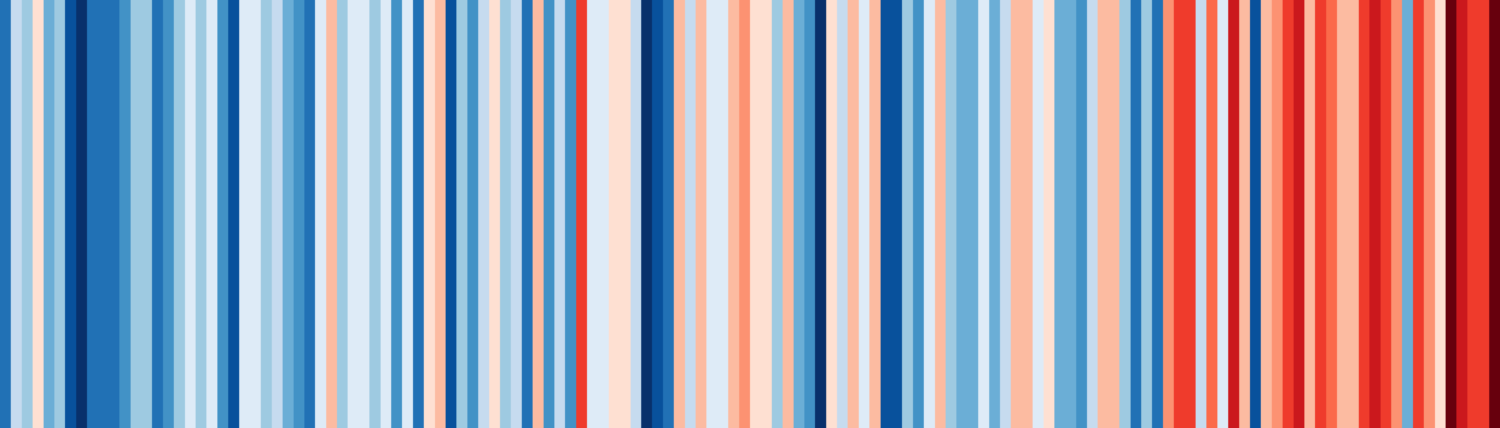Eine unbewohnbare Erde?
 „Es ist schlimmer, viel schlimmer als Sie denken.“ So beginnt der amerikanische Journalist David Wallace-Wells sein 2019 erschienenes Buch über die Folgen der schnell voranschreitenden Erderwärmung (eine Kurzfassung der wichtigsten Thesen kann man hier lesen). Spätestens der Hitzesommer 2018 hat auch die Menschen im industrialisierten Europa spüren lassen, dass die Erderwärmung kein weit in der Zukunft liegendes Problem ist, das überdies nur Menschen in ärmeren Ländern und in Küstennähe betrifft. Monatelang fiel kein Tropfen Regen; Europa, sonst ein üppig grüner Kontinent, färbte sich braun auf den Bildern, die die Internationale Raumstation an die Bodenstationen funkte.
„Es ist schlimmer, viel schlimmer als Sie denken.“ So beginnt der amerikanische Journalist David Wallace-Wells sein 2019 erschienenes Buch über die Folgen der schnell voranschreitenden Erderwärmung (eine Kurzfassung der wichtigsten Thesen kann man hier lesen). Spätestens der Hitzesommer 2018 hat auch die Menschen im industrialisierten Europa spüren lassen, dass die Erderwärmung kein weit in der Zukunft liegendes Problem ist, das überdies nur Menschen in ärmeren Ländern und in Küstennähe betrifft. Monatelang fiel kein Tropfen Regen; Europa, sonst ein üppig grüner Kontinent, färbte sich braun auf den Bildern, die die Internationale Raumstation an die Bodenstationen funkte.
Das Unglück kommt in Kaskaden
2018 konnte man bewusst wahrnehmen, was Wallace-Wells meint, wenn er schreibt, dass die Auswirkungen des Klimawandels als „Kaskaden“ über uns hereinbrechen werden: Hitze und Trockenheit gemeinsam ließen die Trinkwasserreserven auf einen bedenklichen Tiefstand sinken. Vielerorts verdorrte die Ernte; die Bauernproteste des Jahres 2019 sind vermutlich Zeichen einer tiefen Verunsicherung eines ganzen Berufsstandes, der massiv an seine Abhängigkeit nicht nur von staatlichen Regelungen, sondern ebenso von der Natur erinnert worden ist. Die Trockenheit setzte auch den Wäldern zu, die von Waldbränden heimgesucht wurden, so dass beispielsweise im August 2018 in ganz Berlin Brandgeruch von einem 50 km entfernten Großbrand wahrzunehmen war. Im folgenden Jahr litt der Wald dann zusätzlich unter Borkenkäfern. Niedrigwasser in den Flüssen behinderte nicht nur die Binnenschifffahrt, sondern auch die Kühlung von Kraftwerken, die deshalb abgeschaltet oder in ihrer Leistung reduziert werden mussten.
Der beginnende Klimawandel zeigt sich eben nicht nur in einzelnen Ereignissen, sondern fast immer auch in Folgeschäden oder – noch schlimmer – in sich selbst verstärkenden Rückkopplungseffekten: die Trockenheit erhöht die Waldbrandgefahr, durch Waldbrände wird in den Wäldern gebundenes Kohlendioxid freigesetzt, was wiederum den Klimawandel beschleunigt. Zu den gefährlichsten dieser Kipp-Punkte zählt das Auftauen des sibirischen Permafrostbodens: in ihm sind große Mengen des besonders klimaschädlichen Methans gebunden. Sobald dieser sich selbst verstärkende Prozess einsetzt, wäre es auch mit der besten Klimapolitik nicht mehr möglich, die Erwärmung der Atmosphäre unter Kontrolle zu bekommen.
Klimaziele nicht mehr erreichbar?
Nach derzeitigen Schätzungen wird sich der Anstieg der Erderwärmung bis 2100 nur dann deutlich unter 2 Grad halten lassen, wenn sehr schnell radikale Maßnahmen ergriffen werden, um den CO2-Ausstoß drastisch zu reduzieren. Im Augenblick – so das Fazit eines Berichts der Vereinten Nationen aus dem November 2019 – bewegt sich die Welt bestenfalls auf eine Durchschnittstemperatur zu, die im Jahre 2100 um 3,2 Grad über der vorindustriellen Zeit liegen könnte.
Technisch ist es immer noch möglich, der Erderwärmung auf das von der Pariser Klimakonferenz angepeilte Ziel von deutlich unter 2, besser 1,5 Grad zu begrenzen. Dazu müsste aber der Ausstoß von Kohlendioxid ab sofort deutlich sinken. Stattdessen steigt er weiter. Der fehlende politische Wille zum Umsteuern sorgt dafür, dass die Pariser Klimaziele auch technisch gesehen bald außer Reichweite sein werden. Und der Klimawandel wird im Jahr 2100 nicht zu Ende sein, nur weil unsere Prognosen in der Regel bei der Jahrhundertwende stoppen. Auch eine Erwärmung um 4, 6 oder 8 Grad liegt im Bereich des Möglichen, auch wenn wir heute nur ahnen können, wie solch eine Höllenwelt wohl aussehen würde. Was wir aber wissen: jedes Zehntelgrad mehr bedeutet eine immense Zunahme an menschlichem Leid, und deshalb lohnt es sich, um jedes Zehntelgrad zu kämpfen.
Und die zerstörerischen Folgen der Erderwärmung erreichen inzwischen auch die reichen Industrieländer. Für 2018 zählte Germanwatch Deutschland zu den drei am stärksten von Extremwetter betroffenen Staaten weltweit, gleich nach Japan und den Philippinen. Grund dafür waren die Hitzewelle, die Rekorddürre und die beiden Orkantiefs „Friederike“ und „Fabienne“.
Es wird viele von uns treffen – und auf jeden Fall unsere Kinder
Denken wir konkret: das Durchschnittsalter der Bevölkerung Deutschlands liegt – unterschiedlich nach Geschlechtern und Regionen – irgendwo zwischen 40 und 45 Jahren. Der durchschnittliche Deutsche hat also – statistisch gesehen – noch etwa ebensoviele Jahre zu leben. Wenn der politische Wille zum Klimaschutz weiterhin so schwach bleibt wie bisher, wird dieser Durchschnittsdeutsche als Rentner in einer Welt leben, die bereits das Zwei-Grad-Limit überschritten hat.
Die Lebenserwartung eines heute geborenen Kindes liegt rein statistisch bei etwas mehr als 80 Jahren. Viele der heute geborenen Kinder werden also wahrscheinlich noch den Beginn des nächsten Jahrhunderts erleben. Sie werden dann – wenn wir weitermachen wie bisher – in einer gegenüber der vorindustriellen Zeit um drei bis vier Grad wärmeren Welt leben. Wenn wir also über die Zukunft unseres Planeten bei weiter steigenden Durchschnittstemperaturen reden, dann geht es um Szenarien, die viele von uns noch selbst erleben werden. Auf jeden Fall wird es die Generation unserer Kinder und Enkel treffen. In der Regel sind das die Menschen, die uns ganz besonders am Herzen liegen. Was also haben sie und wir zu erwarten in einer Welt, deren Durchschnittstemperatur um zwei bis vier Grad über der der vorindustriellen Zeit liegt?