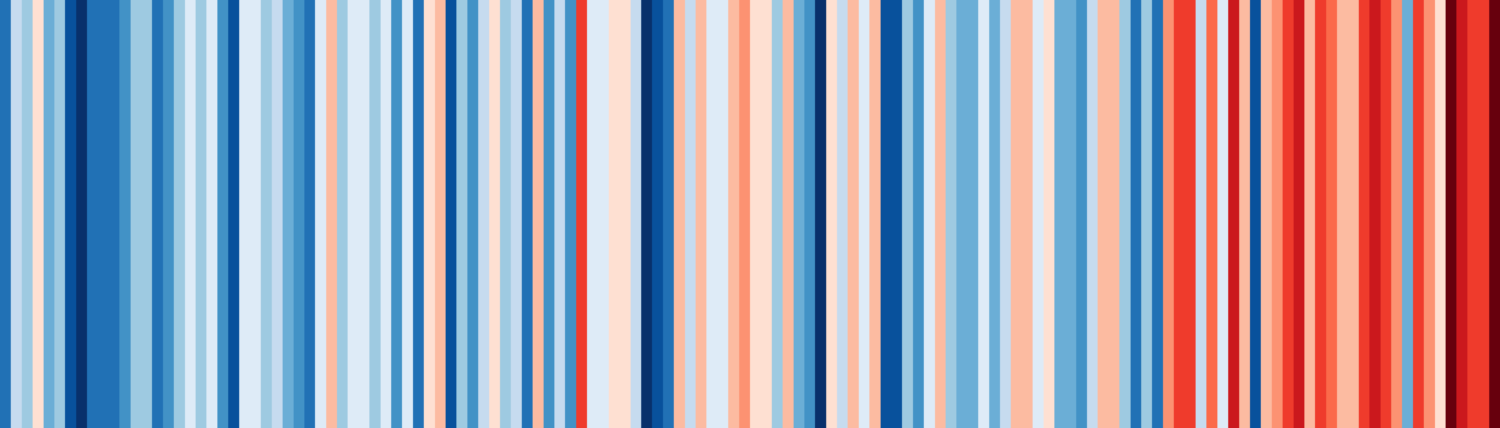Kirche vor dem Paradigmenwechsel

Der Mennonit Gerald Ens hat es gewagt, nach einer Kirche zu fragen, die auch auf einem sterbenden Planeten ihrem Auftrag treu bleibt. Ens sagt: So sehr wir darauf hoffen und uns dafür einsetzen sollten, dass die Klimakatastrophe abgewendet werden kann – es ist dennoch realistisch, damit zu rechnen, dass uns selbst im besten annehmbaren Fall immer noch schreckliche Katastrophen mit vielen Opfern bevorstehen. Vorsichtig und sozusagen versuchsweise denkt er darüber nach, wie eine Kirche aussehen könnte, die auch mitten in solchen Zeiten der Verheerung Kirche ist.
Ich möchte seine Frage aufgreifen und seine tastenden Überlegungen – ebenso vorsichtig und versuchsweise – mit meinen eigenen verbinden. Nun könnte man das sicher als Resignation deuten und dagegen einwenden, dass es glücklicherweise noch zu früh ist für solche Gedanken. Sollten wir nicht alle Kraft darauf verwenden, wirksame Maßnahmen gegen die heraufziehende Klimakatastrophe zu fordern? Sind Gedanken, die das Scheitern dieser Bemühungen voraussetzen, nicht kontraproduktiv und lähmend? Ja, das ist denkbar. Wer resigniert und aufgibt, hat schon verloren. Und wir sollten als Christen auch nie die Hoffnung auf Wunder aufgeben.
Vor einer Zeit nicht endenwollender Katastrophen?
Andererseits könnte so ein Denken vom Ende her auch jetzt schon wichtige Hinweise geben für eine Kirche, die ihre prophetische Stimme gegen unseren selbstmörderischen Lebensstil erhebt. Es sind ähnliche Fähigkeiten, die vor, aber auch während einer möglichen Klimakatastrophe gebraucht werden. Und vielleicht müssen wir uns auch erst die Vorstellung aufgeben, die Klimakatastrophe sei etwas, was zu einem bestimmten Zeitpunkt eintritt und dann – wie einer der großen Weltkriege – irgendwann auch wieder beendet ist. Vielleicht steht uns ja kein plötzlicher Knall, sondern eine nicht enden wollende Zeit der Unsicherheit und der Katastrophen bevor. Vielleicht ist die Corona-Pandemie ja gerade durch ihr Nicht-enden-Wollen der Vorbote einer Zeit, in der es keine Normalität mehr gibt. Sich (gemeinsam!) gedanklich darauf vorzubereiten, kann auch jetzt schon eine Energiequelle sein. Alles, was uns hilft, ins Handeln zu kommen, hilft uns auch, die lähmende Ohnmacht zu überwinden. Deshalb folgen nun einige (vorläufige und ergänzungsbedürftige) Gedanken zu einer Kirche der Zukunft, die in einer dystopischen Situation dringend gebraucht würde, aber auch jetzt schon als Orientierungspunkt für den Weg unserer Gemeinden dienen kann.
Hilfreiche Erinnerungen
Unterstützt werden solche Gedanken von Erinnerungen an Zeiten, in denen Gottes Leute schon einmal eine wichtige Rolle in gesellschaftlichen Krisen und Umbrüchen übernommen haben. Sicherlich ist die heraufziehende Klimakrise eine historisch einzigartige Situation. Subjektiv haben Menschen aber auch früher erlebt, dass ihre Lebenswelt an ihr Ende kam und sie sich schutzlos einer feindlichen Umwelt ausgesetzt sahen. Manchmal haben christliche Gemeinschaften dann Hilfe bieten können. Hier geht es nicht um den (nie bewiesenen) Gedanken, dass Menschen in Krisenzeiten „wieder in die Kirche kommen“ und die Kirche endlich die ihr zukommende Stellung in der Gesellschaft einnehmen kann. Es geht nicht um irgendwelche Ansprüche. Vielmehr ist es Christen gar nicht so selten gelungen, in Krisenzeiten tatsächlich ihrer Berufung als Salz und Licht gerecht zu werden und der Gesellschaft Hilfe und Orientierung zu geben. Diese Zeiten zu erinnern, kann uns ermutigen, auch in der Gegenwart unsere Möglichkeiten nicht zu unterschätzen.
Dem Christentum liegt die Bekanntschaft mit Extremsituationen jeder Art sozusagen in den Genen. Schon die im Alten Testament festgehaltenen Krisen- und Katastrophenerfahrungen Israels gehören in den Horizont christlichen Denkens. Hinzu kommen die speziell christlichen Erfahrungen von der Kreuzigung Jesu über die Entschlossenheit der Märtyrer bis hin zu den Katastrophenszenarien der Offenbarung und die Leidensgeschichten von Christen aus allen Zeitaltern. Vielfältig ist die christliche Tradition (nicht unbedingt der einzelne Christ) mit der Möglichkeit katastrophaler Ereignisse vertraut. Das heißt aber nicht, dass Christen solche Situationen herbeisehnen, womöglich als „missionarische Gelegenheit“. Zu gut wissen wir, mit welch großem Maß an menschlichem Leid sie verbunden sind. Zu Recht fürchten auch wir uns vor den Erschütterungen, die mit großer Wahrscheinlichkeit auf uns und unsere Kinder und Enkel zukommen werden. Dennoch können wir darauf vertrauen, dass uns im richtigen Moment aus unserer Tradition auch angemessene Reaktionsmöglichkeiten für Extremsituationen zuwachsen werden.
Wir müssen reden, damit damit der Paradigmenwechsel gelingen kann
Krisen haben die Kirche immer wieder herausgefordert, ihre Berufung in neuem Licht zu sehen. Dabei geht es zunächst einmal um eine Horizonterweiterung, insbesondere bei den Verantwortlichen, und um erste Schritte in eine neue Richtung. Kirchengemeinden sind in der Realität häufig Freizeiteinrichtungen, die in harter Konkurrenz zu anderen Angeboten der Freizeitgestaltung stehen. Sich als hilfreiche Akteure für die Umwelt in potentiell lebensbedrohlichen Situationen zu sehen, ist ein ziemlich radikaler Paradigmenwechsel.
Solche Paradigmenwechsel gelingen häufig nur unter massivem äußeren Druck. Aber auch in diesem Fall ist es nicht selten entscheidend, dass zumindest Teile der Leitungsgruppe auf diese Situation vorbereitet sind und angesichts einer aktuellen Krise schnell Konzepte für eine angemessene Reaktion entwickeln können. Je radikaler solch ein Wechsel ist, um so intensiver muss (gemeinsam!) nachgedacht werden – und zwar rechtzeitig.