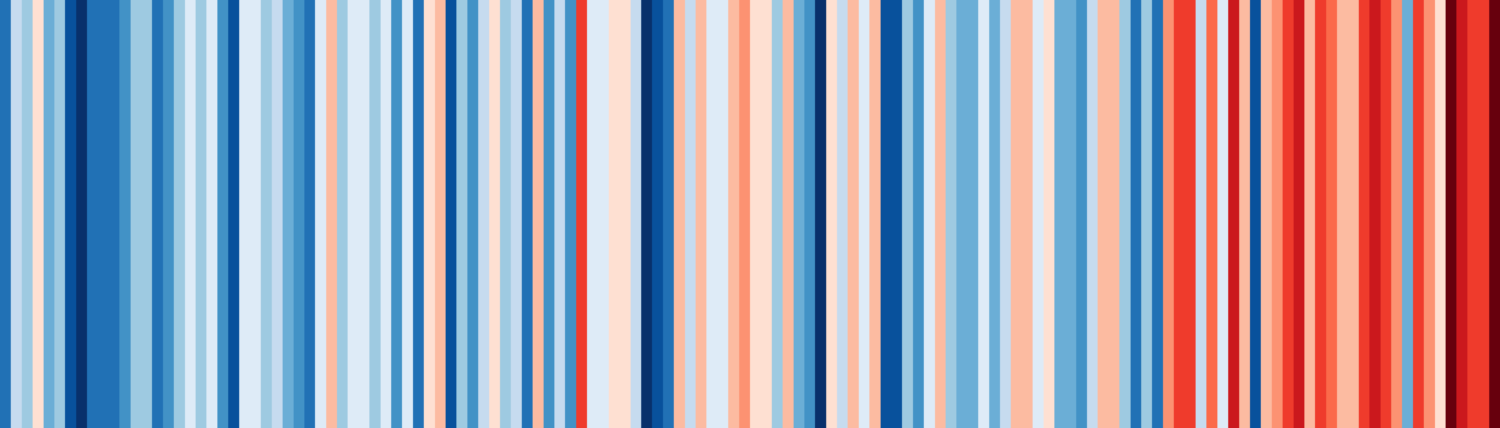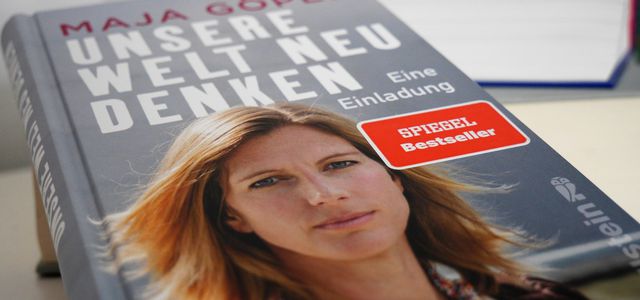
Rütteln an Denkbarrieren
Zum Buch „Unsere Welt neu denken“ von Maja Göpel
Es ist ein deutliches Zeichen, wenn in Corona-Zeiten ein Sachbuch zur Nachhaltigkeit nach einem guten halben Jahr schon die neunte Auflage erreicht. Das liegt in diesem Fall vermutlich am glücklichen Zusammentreffen eines aktuellen Themas, einsichtiger Lösungsvorschläge und eines sehr gut lesbaren Schreibstils.
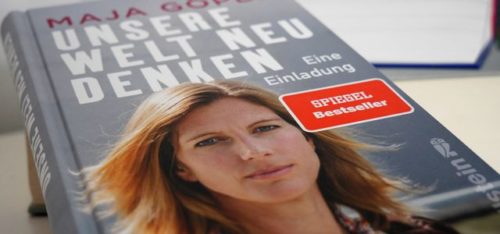 Prof. Maja Göpel geht in ihrem Buch der Frage nach, was uns hindert, Konsequenzen aus den eigentlich allseits bekannten Folgen unseres gegenwärtigen Lebensstils zu ziehen. Sie verzichtet auf die detaillierte Darstellung dieser Folgen – das ist nicht ihr Thema. Entscheidend ist der Übergang zu einer »vollen« Welt: bis weit ins 20. Jahrhundert hinein erlebte die Menschheit die Erde als Raum mit unbegrenzten Ressourcen. Erst mit dem Bericht des Club of Rome von 1972 sind die Grenzen des Planeten (und damit die »Grenzen des Wachstums«) sichtbar geworden. Damit ist für die Menschheit eine völlig neue Lage entstanden.
Prof. Maja Göpel geht in ihrem Buch der Frage nach, was uns hindert, Konsequenzen aus den eigentlich allseits bekannten Folgen unseres gegenwärtigen Lebensstils zu ziehen. Sie verzichtet auf die detaillierte Darstellung dieser Folgen – das ist nicht ihr Thema. Entscheidend ist der Übergang zu einer »vollen« Welt: bis weit ins 20. Jahrhundert hinein erlebte die Menschheit die Erde als Raum mit unbegrenzten Ressourcen. Erst mit dem Bericht des Club of Rome von 1972 sind die Grenzen des Planeten (und damit die »Grenzen des Wachstums«) sichtbar geworden. Damit ist für die Menschheit eine völlig neue Lage entstanden.
Göpel geht nun als Gesellschaftswissenschaftlerin auf die Suche nach den Gründen, die bisher verhindert haben, dass sich die Menschheit in ihrem Wirtschaften auf diese neue Situation einstellt. Sie sieht die Ursachen dafür in grundlegenden Denkmustern, auf denen unsere Institutionen (vor allem die ökonomischen) aufbauen. Dazu gehört vor allem die Figur des homo oeconomicus, der das Menschenbild der Wirtschaftswissenschaft prägt: ein fiktives Wirtschaftssubjekt, das alles in Geld umrechnet und seine Entscheidungen allein auf dieser Grundlage trifft.
Dieses Menschenbild ist zwar realitätsfern. Wenn es aber in einer zentralen Disziplin wie der Wirtschaftswissenschaft zur Denkgrundlage wird, beginnen Menschen, sich danach zu verhalten, weil solch ein Verhalten vom System belohnt wird.
Entsprechend sieht Göpel Lösungen in einem veränderten Welt- und Menschenbild, das vor allem auf einer neuen Lektüre der ökonomischen Klassiker (Smith, Ricardo und auch Darwin) beruht. Sie entdeckt dort Gedankengänge, von denen aus die neoliberale Ökonomie als Verengung der Gedanken der liberalen Klassiker erscheint. Auch ein kurzer Hinweis auf die buddhistische Wirtschaftslehre ergänzt diese Wertgrundlage.
Auf dieser Grundlage sieht Göpel vor allem zwei Schwerpunkte, bei denen eine Korrektur der gegenwärtigen Denkgrundlagen dringend geboten ist:
- Die Rolle des Staates:
der Staat ist in seiner Rolle als Vertreter übergreifender Interessen grundsätzlich nicht ersetzbar. Die am Markt organisierten Einzelinteressen können weder die übergreifenden Interessen der Gesamtgesellschaft noch die Interessen künftiger Generationen vertreten. Die grundlegenden Regeln des Marktes können nicht von ihm selbst gesetzt werden. Insbesondere die Kosten des Umweltverbrauchs müssen durch eine externe Instanz eingebracht werden, weil sie sonst in der ökonomischen Rechnung nicht auftauchen und damit auch nicht als Realität anerkannt werden. - Umweltfragen sind Gerechtigkeitsfragen:
Gegenüber dem Scheinwiderspruch zwischen der sozialen und der ökologischen Problematik besteht Göpel darauf, dass Umweltfragen immer Verteilungsfragen und damit Gerechtigkeitsfragen sind. Ökologische Probleme sind nur lösbar, wenn dieser Zusammenhang beachtet wird. In einer »vollen« Welt geht es immer um die Frage, wer mehr und wer weniger vom Kuchen abbekommt, der wegen der Grenzen des Wachstums nicht größer, sondern eher kleiner werden wird. Auf die, die am wenigsten zur Zerstörung der menschlichen Lebensgrundlagen beigetragen haben – die Armen und die künftigen Generationen – wird im Augenblick der größte Teil der Konsequenzen dieser Lebensweise abgeschoben.
Trotz der anspruchsvollen Thematik und des breiten Horizonts ist Göpels Buch sehr lesefreundlich. Es verzichtet weitgehend auf einen absichernden Anmerkungsapparat und stellt stattdessen in einem Anhang wichtige Literatur und Internetquellen vor.
Interessant ist aus unserer Perspektive, dass Göpel die der gegenwärtigen Ökonomie zugrunde liegenden Welt- und Menschenbilder deutlich herausarbeitet: die Grenzen unserer Veränderungsmöglichkeiten werden durch diesen Denkrahmen definiert. Damit thematisiert das Buch philosophische, man könnte auch sagen: implizit theologische Fragen. Die von Göpel identifizierten »selbst gemachten Regeln, aus denen die Welt, wie wir sie kennen und uns eingerichtet haben, besteht« sind nicht weit entfernt von den »Mächten und Gewalten« die biblisch gesehen die Gesellschaft im Griff haben.
Obwohl hier durchaus Anschlussfähigkeit besteht, stellt Göpel diese Verbindung nicht her. Kirche, Theologie und Christentum kommen in dem Buch nicht vor, obwohl die kirchliche Sphäre durchaus kräftig zum breiten Bewusstsein über ökologische Themen beigetragen hat. Auch die Enzyklika »Laudato si« von Papst Franziskus taucht in den Hinweisen zur Vertiefung nicht auf.
Man sollte das der Autorin aber nicht zum Vorwurf machen; es schmälert auch nicht die Qualität ihres lesenswerten Buches. Man wird einfach davon ausgehen können, dass Göpel weder in ihrer Biografie noch bei ihrer Arbeit in akademischen Institutionen in nennenswerten Kontakt mit kirchlichen Akteuren gekommen ist. Um so wichtiger ist es, dass der Anschluss dann wenigstens von kirchlich-theologischer Seite aus hergestellt wird.